Das Energierecht in Deutschland hat sich über viele Jahre hinweg entwickelt und ist heute ein breites Netz aus Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien. Einige der Regeln stammen noch aus einer Zeit, in der die dezentrale Erzeugung und Einspeisung von Energie undenkbar waren. Während sich das in Hinsicht auf größere Photovoltaikanlagen in den letzten Jahren bereits verändert hat, wurden Balkonkraftwerke bis vor sehr kurzer Zeit nicht in der Rechtsprechung erwähnt. Das änderte sich erst im Jahr 2022/23. In dieser Zeit wurden in kurzer Abfolge und von mehreren Institutionen wie dem Bundesrat, der Justizministerkonferenz oder auch dem Umweltbundesamt Vereinfachungen für Balkonkraftwerke, bzw. Steckersolargeräte, wie die Rechtsnomenklatur die Geräte nennt, gefordert. Dem ging jahrelange Arbeit hinter den Kulissen voraus, bei der Aktivisten und Solarpioniere die Hürden für die Durchsetzung der Balkonphotovoltaik erlebten, benannten und sich in Foren, auf Plattformen und Veranstaltungen darüber austauschten, Lösungen fanden und sich organisierten.

Das Projekt PVPlug der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie etwa wurde für seine erfolgreichen Bemühungen um eine normative Freigabe der Einspeisung ins Wohnungsnetz 2018 mit dem Georg-Salvamoser-Preis ausgezeichnet, die Plattform MachDeinenStom.de erreichte für die Schaffung des ersten länderübergreifenden einheitlichen Anmeldeverfahrens für Balkonkraftwerke 2020 einen Platz auf dem Siegertreppchen beim Green Product Award und der Solarpionier Holger Laudeley erhielt 2021 den Werner-Bonhoff-Preis für seinen unerbittlichen Kampf gegen die bürokratischen Hürden für das Balkonkraftwerk.
Zuletzt war es die „Arbeitsgemeinschaft Balkonkraftwerk“, welche über die #PetitionBalkonSolar Anfang 2023 konkrete Forderungen für Gesetzesänderungen zum Bürokratieabbau für Balkonkraftwerke an den Bundestag richtete. Die unter dem Dach der Initiative organisierten Akteure, wie der Verein Balkon.Solar, die Balkonsolar-Beratungsagentur EmpowerSource, der bekannte YouTuber Andreas Schmitz („der Akkudoktor“) und weitere, konnten über 100.000 Unterschriften einsammeln und erreichten damit in die Top10 aller jemals beim Bundestag eingereichten Petitionen.

Ihre Forderungen waren:
- die Erhöhung der freigegebenen Leistungsgrenze von 600 auf 800 Watt,
- der Wegfall der Anmeldepflicht beim Netzbetreiber,
- der Wegfall der Pflicht zum Zählerwechsel,
- die Vereinfachung der Anmeldung beim Marktstammdatenregister, sowie
- die Privilegierung und damit grundsätzliche Freigabe von Balkonkraftwerken in Wohneigentums- und Mietrecht.
Schon kurze Zeit nach deren Einreichung veröffentlichte das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) seine Solarstrategie und selbige beinhaltete beinahe alle geforderten Punkte. In den folgenden Monaten wurden durch das BMWK sowie das Justizministerium entsprechende Gesetzesentwürfe zur Umsetzung der Forderungen veröffentlicht und in die Parlamente eingebracht. Sie beinhalten Anpassungen von Erneuerbare Energien Gesetz (EEG), Marktstammdatenregisterverordnung (MaStRV), Wohneigentumsgesetz (WEG) und Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB). Alle Gesetzesvorhaben sind entweder bereits verabschiedet oder werden es zeitnah sein.
Diese Entwürfe enthalten auch erstmals eine Definition des Balkonkraftwerks unter dem Rechtsbegriff „Steckersolargerät“. Diese lautet: „ein Gerät, das aus einer Solaranlage oder aus mehreren Solaranlagen, einem Wechselrichter, einer Anschlussleitung und einem Stecker zur Verbindung mit dem Endstromkreis eines Letztverbrauchers besteht“ (Zitat aus dem neuen §3 des EEG im Solarpakets I, a.k.a. „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften zur Steigerung des Ausbaus photovoltaischer Energieerzeugung“). Dabei darf man sich an der irreführenden Verwendung des Begriffs „Solaranlage“ nicht stören. Mit diesem werden im Gesetz Solarmodule bezeichnet.
Hier die weiteren Änderungen durch die beiden Gesetzesentwürfe im Überblick:
Anmeldepflicht beim Netzbetreiber

Der Wegfall der Anmeldung beim Netzbetreiber wird im neuen Absatz 5a des Paragraphen 8 EEG geregelt. Dort heißt es „Ein Steckersolargerät oder mehrere Steckersolargeräte mit einer installierten Leistung von insgesamt bis zu 2 Kilowatt und einer Wechselrichterleistung von insgesamt bis zu 800 Voltampere, die hinter der Entnahmestelle eines Letztverbrauchers betrieben werden und der unentgeltlichen Abnahme zugeordnet werden, können unter Einhaltung der für die Ausführung eines Netzanschlusses maßgeblichen Regelungen angeschlossen werden. Registrierungspflichten nach der Marktstammdatenregisterverordnung bleiben unberührt; zusätzliche gegenüber dem Netzbetreiber abzugebende Meldungen von Anlagen nach Satz 1 können nicht verlangt werden.“
Hier fällt neben der neuen Grenze von 800 Voltampere (Watt) gleich die zusätzliche Begrenzung der Modulleistung ins Auge. Zunächst scheint es nicht nachvollziehbar, die Leistung der Module auf 2 Kilowatt zu beschränken, denn schließlich ist es doch die Leistung des Wechselrichters, welcher auf die elektrischen Leitungen wirkt. Der Grund, warum diese Angabe dennoch ihren Weg in das Gesetz gefunden hat, ist einfach: Das EEG kannte bis zu dieser Änderung keine Wechselrichterleistung. Auch die Regelungen für Aufdach- und Freiflächen-Solaranlagen wurden bisher stets an der Modulleistung festgemacht. Eine vollständige Abkehr von dieser Praxis war daher auch bei Balkonkraftwerken nicht möglich. Allerdings dürfte das für die meisten Steckerkraftwerke keine Probleme bereiten, denn gängige Systeme kommen aktuell gerade einmal auf die Hälfte dieser Modulleistung. Das wiederum hat allerdings auch technische Gründe, auf die hier nicht eingegangen werden kann.
Anmeldung beim Marktstammdatenregister
Der Wegfall der Anmeldung beim Netzbetreiber bedeutet keine Anmeldefreiheit. Auch heute gilt nämlich zusätzlich die gesetzliche Pflicht zur Registrierung des Balkonkraftwerks und seines Betreibers im Marktstammdatenregister. Wie das genau geht, steht in diesem Artikel. Der Eintrag dort ist im Grunde recht schnell erledigt und bringt meist wesentlich weniger Abstimmungsaufwand mit sich als die mittlerweile hinfällige Auseinandersetzung mit dem Netzbetreiber. Dennoch war er für viele Nutzer eine Hürde, da er zum Teil mit Begriffen aufwartete, mit denen sich Laien zum Glück für gewöhnlich nicht beschäftigen müssen. Nicht jeder weiß auf Anhieb, ob bei einem Balkonkraftwerk Voll- oder Teileinspeisung gilt, oder auf welcher Spannungsebene es betrieben wird. Daher forderte die Petition auch eine Vereinfachung der Nutzerführung bei der Registrierung von Balkonkraftwerken. Diese ist zum Glück zm 1.4.2024 auch erfolgt.
Zählerwechsel
Über Jahre wurde behauptet, dass das unkontrollierte Einspeisen von Überschüssen aus dem Balkonkraftwerk rechtswidrig sei. Dabei bezog man sich auf die bei Rückspeisung zum Teil rückwärtslaufenden „Ferraris-Zähler“ mit Drehscheibe, welche bis vor einigen Jahren der Standard bei den Stromzählern waren.

Die Balkonsolar-Petition forderte, dieses Rückwärtslaufen (sog. “Net-Metering”) zu erlauben, konnte dies aber nicht vollständig durchsetzen. Allerdings sieht der Entwurf dennoch eine wesentliche Vereinfachung vor und ist dabei überraschend kreativ. Zwar hat nach dem neuen Paragraphen 10a des EEG auch weiterhin „der Messstellenbetreiber Messstellen an Zählpunkten von Steckersolargeräten […] mit einer modernen Messeinrichtung als Zweirichtungszähler […] auszustatten“ (die Petition hatte hier auf eine Duldung bis zum ohnehin verpflichtenden Einbau im Rahmen des “Smart-Meter Rollouts” gehofft), aber der Nutzer muss nicht mehr darauf warten, bis der Tausch erfolgt ist. Er kann sein Balkonkraftwerk sofort einstecken und Sonne ernten, auch wenn ein alter Zähler dann rückwärtsläuft. Warum das nicht zu Problemen führt, wie jahrelang behauptet? Weil man einfach so tut, als würde es nicht passieren! In Juristen deutsch: „Die Richtigkeit der von der Messeinrichtung ermittelten Messwerte wird […] vermutet“. Wer hätte gedacht, dass es so einfach geht, wenn man nur will? In der Praxis haben bereits einige Netzbetreiber von sich aus damit begonnen, auf den Zählerwechsel direkt nach Anmeldung eines Balkonkraftwerks zu verzichten, da dieser aufgrund der anstehenden Modernisierung der Zähler in Deutschland ohnehin in den nächsten Jahren ansteht und die separate Bearbeitung bei immer stärker steigenden Anmeldezahlen eine enorme Mehrarbeit bedeuten würde.
Balkonkraftwerke und steuerbare Verbraucher
Dies war ursprünglich keine Forderung der Petition. Dennoch soll der neue Absatz 1 des Paragraphen 9 EEG bestimmen, dass die Pflicht zur Auslesbarkeit/Fernsteuerbarkeit von Solaranlagen in Verbindung mit steuerbaren Verbrauchsgeräten nach dem erst seit 2024 in Kraft getretenen neuen §14a EnWG nicht für Balkonkraftwerke gilt. Das ist dennoch sinnvoll, denn solche steuerbaren Verbrauchsgeräte werden in Zukunft häufiger werden. Sie können nämlich durchaus attraktiv sein. So kann künftig etwa vereinbart werden, dass die heimische Wallbox zu Tageszeiten mit weniger Energie im Netz das E-Auto langsamer lädt, um das Stromnetz zu entlasten. Der Netzbetreiber verzichtet im Gegenzug dann auf einen Teil der Netzentgelte. Wer solche Möglichkeiten nutzt und zugleich eine Solaranlage betreibt, der muss eigentlich zusätzlich Technik zum Auslesen der Einspeiseleistung oder gleich zur Abregelbarkeit der Solaranlage (im Fall von zu viel überschüssigem Strom im Netz) einbauen. Bei einem Balkonkraftwerk wäre das übertrieben, daher wurde eine gesetzliche Ausnahme geschaffen.
Balkonkraftwerke und andere PV-Anlagen
Gleiches gilt für den Absatz 3 desselben Paragraphen. Dort geht es um die Zusammenlegung mit anderen PV-Anlagen auf demselben Grundstück oder Gebäude, etwa auf dem Dach. Das ist wichtig, denn andernfalls könnte ein zusätzliches Balkonkraftwerk mit seiner Leistung zur Leistung der bestehenden Anlage gezählt werden und diese damit über bestimmte Grenzwerte kommen, was z.B. wieder die Pflicht zur Fernsteuerbarkeit für die Anlage mit sich brächte. Auch hier brauchte es also eine Ausnahme für das Balkonkraftwerk, welche die Gesetzesänderungen auch umsetzte.
Freigabe von Balkonkraftwerken in Eigentums- und Mietwohnungen
a.k.a. „Recht aufs Balkonkraftwerk“

Dies war die Kernforderung der Petition, denn sie entscheidet über den wesentlichen Faktor für die Durchsetzung des Balkonkraftwerks: die mögliche Nutzung von Balkonen, Fassaden, Dachteilen, Terrassen, Vorgärten und anderen Bereichen mit Sonneneinstrahlung in Miet- und Eigentumswohnungen. Konkret ging es um die Erweiterung der Liste an „privilegierten Maßnahmen“, welche das Wohneigentumsrecht und das Mietrecht vorsieht. Die Liste beinhaltet bisher lediglich den Anspruch, bauliche Veränderungen vornehmen zu dürfen, die dem Gebrauch durch Menschen mit Behinderungen (Rampen, Geländer, Treppenlifte etc.), dem Laden elektrisch betriebener Fahrzeuge (insbesondere Wallboxen), dem Einbruchsschutz (Schlösser/Riegel/Alarmanlagen etc.) und dem Anschluss an ein Telekommunikationsnetz mit sehr hoher Kapazität (insbesondere Glasfaser-Anschluss) dienen. Diese Freigaben wurden erst 2020 eingeführt. Die Nutzung von Photovoltaik wurde damals allerdings nicht integriert. Zumindest für Balkonkraftwerke ist das nun aber einen Gesetzesentwurf des Justizministeriums in den Bereich des Möglichen gerückt. Die Zustimmung zu dieser Änderung kommt allerdings nicht nur aus Kreisen der Ampelregierung. Auch aus der Opposition kam bereits ein eigener, ähnlich lautender Gesetzesentwurf. Daher konnte das Gesetz zur Privilegierung auch fast einstimmig am 04. Juli 2024 im Bundestag verabschiedet werden.
Die Auswirkungen der entsprechenden Änderung sind fundamental. Die Privilegierung bedeutet hier nichts anderes als eine Beweislastumkehr. Während Vermieter und Wohnungseigentümergemeinschaften sowie die durch selbige beauftragten Hausverwaltungen bisher auch ohne Angabe von Gründen die Erlaubnis zur Montage eines Balkonkraftwerks verweigern konnten, bedeutet die Privilegierung eine grundsätzliche Freigabe. Sollten dennoch Argumente gegen das Balkonkraftwerk sprechen, müssen diese stichhaltig begründet werden. Denkbar wären etwa kurzfristig anstehende Instandsetzungsarbeiten an den Balkonen oder der elektrischen Anlage. Befindet sich direkt unter den Balkonen ein Verkehrsweg, dann kann auch dies ein Grund sein, die Freigabe zunächst juristisch abzuklären. Das gilt bereits für Blumenkästen genauso.
Die Hürden, welcher der Denkmalschutz, Erhaltungssatzungen oder ähnliche baurechtliche Regelungen aufwerfen, sind hiervon übrigens nicht betroffen. Diese gelten weiterhin uneingeschränkt und können Balkonsolar-Projekte verhindern. Auf regionaler Ebene gibt es aber immer häufiger Regelwerke, welche diese Beschränkungen reduzieren, wie etwa Klimaschutzrichtlinien. So werden zunehmend Solaranlagen auf Kirchendächern und eben auch Balkonkraftwerke an geschützten Häusern möglich. Es lohnt sich also, sich selbst vor Ort für solche Anpassungen einzusetzen, falls sie nicht bereits vorhanden sind.
Offene Fragen
Trotz der Änderungen gibt es auch weiterhin noch einige letzte Fragen. So ist etwa unklar, was passiert, wenn ein Netzbetreiber trotz gesetzlicher Verpflichtung über Jahre den Zähler nicht tauscht. Das käme im Falle eines für das Rückwärtslaufen anfälligen alten Zählers einer Art „Net-Metering“ gleich, also dem direkten Abzug von eingespeisten Überschüssen vom tatsächlichen Verbrauch – eine Abrechnungsart, die in Deutschland nicht zulässig ist. Insbesondere ist offen, welche Vorgaben zur Umsetzung eines Balkonkraftwerk-Projekts durch Vermieter und Wohnungseigentümergemeinschaften bzw. Hausverwaltungen überhaupt gemacht werden dürfen. Wie exakt können etwa Modulfarbe und -größe vorgeschrieben werden? Ab wann kommen die durch die Vorgaben entstehenden Mehrkosten einer unzulässigen Verhinderung gleich? Kann vorgeschrieben werden, dass das Kraftwerk nur im Innenbereich des Balkons betrieben werden darf, wo wesentlich weniger Sonne hinkommt? Entsprechende Klarstellungen wurde bereits von vielen Experten angemahnt, und zwar vor Inkrafttreten des Gesetzesentwurfs. Andernfalls befürchten sie eine Klagewelle, welche die ohnehin überlasteten Gerichte über Jahre hinweg mit der Klärung dieser Detailfragen beschäftigen wird. Ob diese Klarstellungen rechtzeitig erfolgen, ist noch offen.
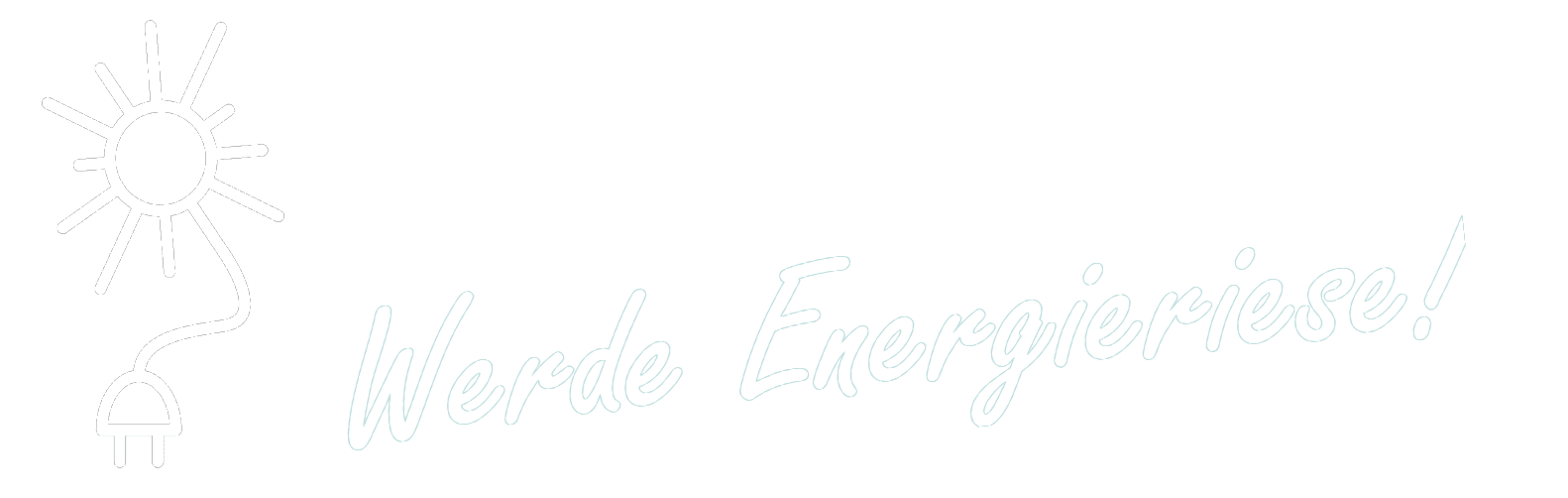


6 Gedanken zu „Sind Mini-Solar-Kraftwerke legal?“
Leider wird hier nicht auf die gesetzliche Grundlage der Leistungsangabe “600W Ausgang Wechselrichter” eingegangen. Mein Versorger besteht derzeit auf die Leistungsbeschränkung auf Basis der Modulleistung!
Hallo Ullrich,
eine gesetzliche Grundlage gibt es hier nicht. Die Norm VDE-AR-N-4105:2018-11 besagt, dass bei einer Geräteleistung von bis zu 600VA(W) die Unterschrift eines “Anlagenerrichters” (=Elektriker) auf dem Inbetriebnahmeprotokoll entfallen darf. Zudem muss kein Lageplan eingereicht werden. Allerdings ist das nicht gleichzusetzen mit einem auf ein A4-Blatt reduzierten Anmeldebogen. Dieser ist eher ein Entgegenkommen der Netzbetreiber und daher können sie prinzipiell auch eigene Regeln festlegen, was die Anlagengrößen angeht, für die sie selbigen zulassen. Natürlich ist es aber nicht sehr nutzerfreundlich, die Modulleistung anzusetzen, insbesondere, da man heutzutage kaum noch Geräte mit unter 600W Modulleistung bekommt. Allerdings kann natürlich auch einem Gerätenutzer beim Ausfüllen ein Fehler passieren und versehentlich die Wechselrichterleistung im Feld für Modulleistungen landen. Als Laie kann das schon mal passieren…
Gibt es eigentlich eine rechtliche Beschränkung der Anzahl der ‘Balkonkraftwerke’ pro Zähler?
Wie ist die Rechtslage, wenn ich also z.B. drei Anlagen á 600W mit jeweils eigenem Stromkreis installieren möchte?
Dieter
Hallo Dieter,
auch hier ist nicht das Gesetz die richtige Anlaufstelle. Die VDE-AR-N-4105:2018-11 legt die Grenze für die vereinfachte Anmeldung auf 600VA(W) pro “Anschlussnutzeranlage” fest. Das ist gleichzusetzen mit “pro Stromzähler”.
Leider wird hier über die Installation und ihre gesetzliche Regelung nichts geschrieben.
Meine Hausverwaltung möchte eine Haftpflicht Versicherung, eine Installation durch einen Fachbetrieb,, eine Überprüfung der Balkonsteckdose mit Kosten Übernahme durch mich, usw. Usw.
Hallo Pasanau,
dies ist Artikel zum allgemeinen Rechtsrahmen. Die aktuellen Informationen für Wohnungseigentümer und Mieter findest du in den entsprechenden beiden Artikeln im Blog:
https://machdeinenstrom.de/balkonkraftwerke-in-der-eigentumswohnung/ und https://machdeinenstrom.de/balkonkraftwerke-in-der-mietwohnung
Durch die anstehenden Änderungen des Miet- und Wohneigentumsrechts, ist hier gerade vieles im Umbruch.